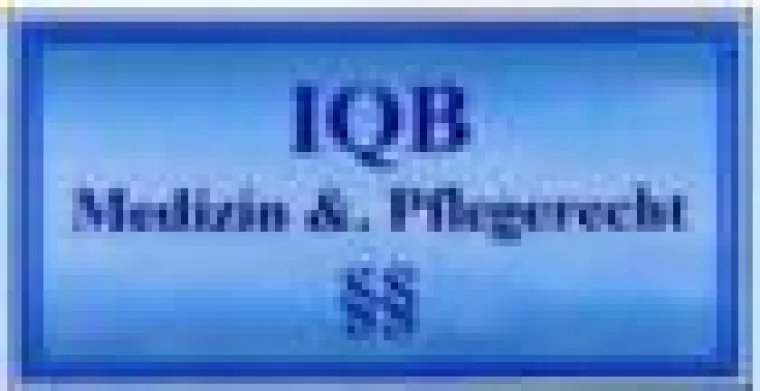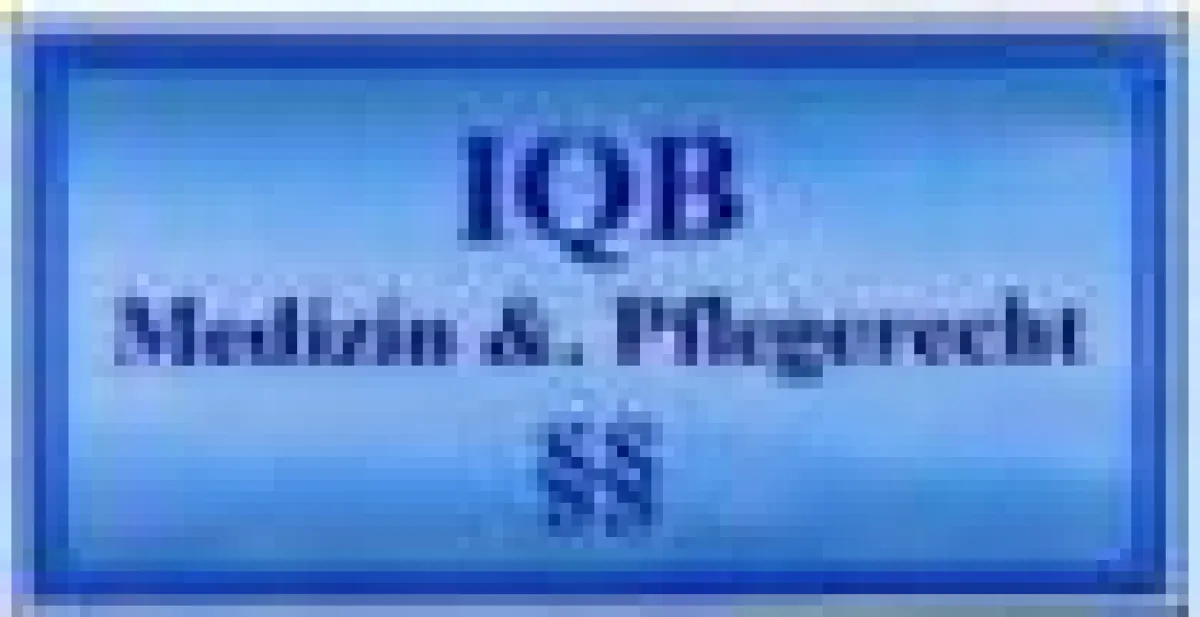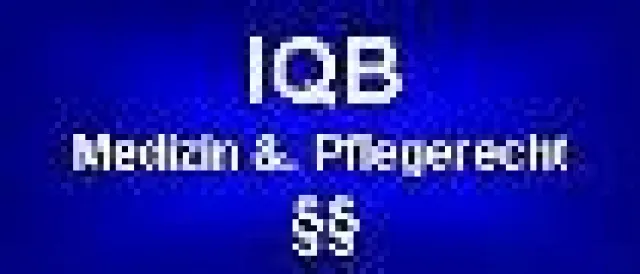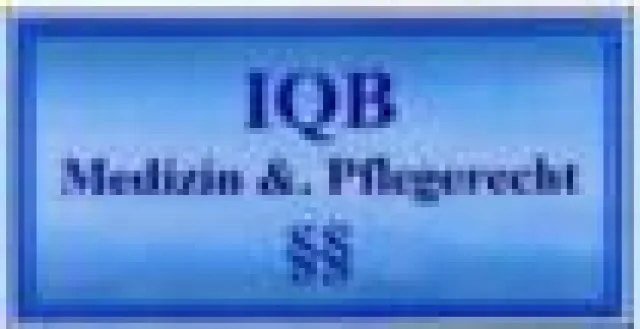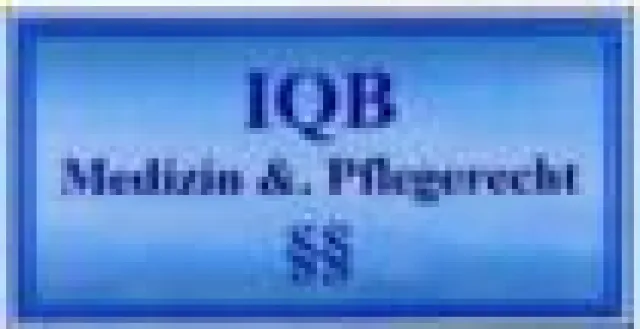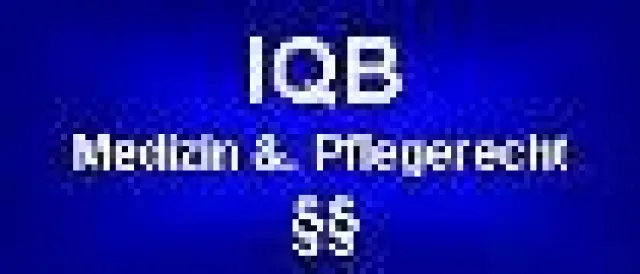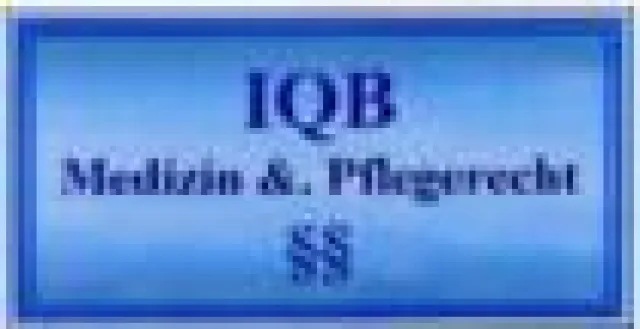(openPR) „Entscheidungen zwischen Leben und Tod sollten vor allem in der Verantwortung des behandelnden Arztes liegen, sagte Hoppe. Die Möglichkeit vorsorglicher Verfügungen sei eine Hilfestellung für Ärzte. Schriftlich niedergelegte Zeugnisse oder mündliche Äußerungen bezögen sich aber immer auf zukünftige Behandlungssituationen. Der Patient könne diese nicht bis in letzter Konsequenz überblicken. Abschließende rechtliche Sicherheiten könne es daher nicht geben“.
Quelle: ZM-online (05.11.07) >>> http://www.zm-online.de/
Kurze Anmerkung (L. Barth):
Während gegenüber die Bundesjustizministerin auf einer Fachtagung in Aachen für eine gesetzliche Regelung plädierte, bekräftigte der BÄK-Präsident Hoppe seine ablehnende Haltung. Die Auffassung des Herrn Hoppe kommt nun allerdings nicht die Wirkung zu, die ihr ggf. in der Öffentlichkeit beigemessen wird. Es handelt sich hierbei um eine „Stimme“ unter vielen, die derzeit in der aktuellen Debatte um Gehör ringt. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten bleibt hiervon freilich unberührt, vermag doch die arztspezifische Bereichsethik den Grundrechten des Patienten keine Schranken setzen. Dies verkennt nachhaltig die BÄK in ihren wohlmeinenden Statements und es obliegt selbstverständlich dem Gesetzgeber, aufgrund der ihm obliegenden grundrechtlichen Schutzpflichten entsprechende Regelungen zu erlassen, die es dem Patienten gestatten, auch seinen antizipierten Willen zu äußern, an dem sich (auch) die Ärzteschaft zu orientieren hat. Wir bedürfen nicht einen den alten medizinischen Paternalismus ersetzenden ethischen Paternalismus durch die Ärzte, sondern die Absicherung der selbstbestimmten Patientenentscheidung. Dem Argument, dass vorsorgliche Verfügungen sich immer auf zukünftige Behandlungssituationen beziehen, kommt lediglich nur ein eingeschränkte Bedeutung zu, zumal nicht ersichtlich ist, warum eine derartige Beurteilung künftiger Situationen dem Patienten verwehrt sein sollte. Entscheidungen zwischen Leben und Tod liegen in erster Linie in der Verantwortung des Patienten, denn nur er ist in der Lage, überhaupt seine Einwilligung in die ärztliche Therapie zu erteilen. Insofern sind die Patientenverfügungen keineswegs nur eine Hilfestellung für die Ärzte, sondern die zwingende Legitimationsbasis für den therapeutischen Eingriff resp. des Unterlassens überhaupt. Die Individualentscheidung des Patienten ist daher bindend und es bedarf keiner Korrektur durch einen medizinethischen Paternalismus, der für sich genommen den Grundrechtsschutz des Patienten nicht gebührend Rechnung trägt. Vollends dramatisch wird es, wenn Medizinethiker (so u.a. Dörner) meinen, Patienten mit einem selbstbestimmten Willen zeichnen sich durch einen „egozentrischen Individualismus“ aus. Ein Blick in das Grundgesetz erleichtert hier den zuweilen übereifrigen Ethikern die Rechtsfindung. Solche Statements belegen einmal mehr, dass aus guten Gründen die Verfassungsinterpretation nicht mit der Philosophie gleichzusetzen ist, so wie es im Übrigen überflüssig ist, darauf hinzuweisen, dass der Mensch (rein chemisch betrachtet), eine „Zellkolonie, die sich kaum von anderen Zellkolonien – ob Vogel, Katze oder Fisch – unterscheidet“ sei (so wohl die Schriftstellerin Lotte Ingrisch) und das sich gegenwärtig die Medizin im „Züchten von Leichen“ übe. Solche Ansichten tragen nicht zur Entmythologisierung des Sterbens bei und sind eher den Bestrebungen hinderlich, weitestgehend die patientenautonome Entscheidung in Form einer gesetzlichen Regelung absichern zu können.